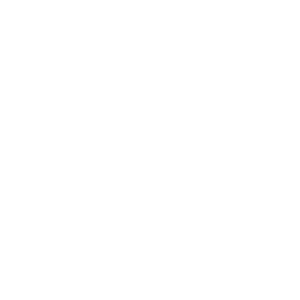Dr. iur. Christoph Good, Stiftungsrat der Robert F. Kennedy Foundation Switzerland & Partner bei Good Rechtsanwälte GmbH
Kaum eine Volksabstimmung in der Schweiz wurde in den letzten Jahren sowohl von Befürworter*innen und Gegner*innen mit derart harten Bandagen und unter Einsatz solch immenser Ressourcen geführt wie die Abstimmung vom letzten Sonntag zur Initiative «Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt». Auch wenn die Initiant*innen letztlich eine knappe Mehrheit der Stimmenden für ihr Anliegen gewinnen konnten (50.7%), scheiterte die Initiative am Ende doch am ebenfalls erforderlichen Ständemehr.
Aus menschenrechtlicher Perspektive mutet der Ausgang der Abstimmung als eine Enttäuschung an. So wäre es nach einer nunmehr fast zehnjährigen Debatte seit der Verabschiedung der UNO-Leitprinzipien für Wirtschaft & Menschenrechte durch den UNO-Menschenrechtsrat (2011) wünschenswert gewesen, erstmals klare, umfassende und vor allem verbindliche Spielregeln für die Frage der unternehmerischen Verantwortung von in der Schweiz domizilierten Konzernen für die Bereiche Menschenrechte und Umweltschutz zu erreichen. Gleichfalls wäre es eine geeignete Gelegenheit gewesen, ein klares Zeichen für die Integrität des Wirtschaftsstandorts Schweiz zu setzen.
Heisst das Abstimmungsresultat, dass das Thema menschenrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen in der Schweiz nun abgehakt ist und es mit business as usual weitergeht? Wohl kaum.
Allein die Zustimmung einer Mehrheit der Abstimmenden – die gleichzeitig muntere Konsument*innen sind – zeigt, dass die Bevölkerung diesbezüglich klare und ernst zu nehmende Erwartungen gegenüber den in der Schweiz domizilierten Unternehmen hat.
Hinzu kommt, dass mit dem letztlichen «Nein» zur Initiative immerhin der indirekte Gegenvorschlag als menschenrechtliches Trostpflaster zeitnah in Kraft treten wird. Auch dies ist auf regulativer Ebene eine Premiere für die Schweiz. So geht der indirekte Gegenvorschlag zwar deutlich weniger weit als die Initiative, führt aber doch zumindest die ersten rechtlich verbindlichen Regeln zum Thema Wirtschaft & Menschenrechte für einen (zwar kleinen aber doch wirkungsmächtigen) Teil der Unternehmen in der Schweiz ein. Kernstück des Gegenvorschlags sind eine Berichterstattungspflicht über sog. «nichtfinanzielle Belange» für grössere Unternehmen (mehr als 500 Vollzeitstellen und Bilanzsumme > 20 Mio. resp. Umsatz > 40 Mio.) sowie eine umfassende Sorgfaltspflicht (= Menschenrechts-Due-Diligence) für Unternehmen, die bestimmte Edelmetalle (Zinn, Tantal, Wolfram oder Gold enthaltende Mineralien oder Metalle aus Konflikt-und Hochrisikogebieten) einführen oder verarbeiten oder Produkte oder Dienstleistungen anbieten, bei denen ein begründeter Verdacht besteht, dass sie unter Einsatz von Kinderarbeit hergestellt oder erbracht wurden. Schon allein aufgrund der engen Verflechtung der Schweizer Wirtschaft und der Tatsache dass die betroffenen Grossunternehmen ihre menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten zur Minimierung ihres eigenen Haftungsrisikos mittels verbindlicher Supplier Codes und Zuliefererverträge innerhalb ihrer Zuliefererketten an die «Kleinen» weitergeben werden, wird letztlich ein deutlich grösserer Adressatenkreis an Unternehmen von den neuen Regulierungen direkt oder indirekt betroffen sein, als dies vom Gegenvorschlag vermutungsweise wohl ursprünglich beabsichtigt war.
Und nicht zuletzt zeichnet sich bereits jetzt durch die diesbezüglichen Regulierungsbemühungen der EU hinsichtlich einer verbindlichen Richtlinie zu corporate due diligence and corporate accountability (voraussichtliche Verabschiedung im Sommer 2021) ab, dass es vermutlich nur eine Frage von kurzer Zeit ist, bis die Schweiz im berühmten sonderweglichen «autonomen Nachvollzug» Regeln übernehmen wird, die sich inhaltlich in einem ähnlichen Rahmen bewegen werden, wie es die Konzernverantwortungsinitiative verlangt hat.
Das Thema wird uns also in jedem Falle weiter begleiten und auch zukünftig einen Schwerpunkt in unserer Stiftungsarbeit bilden. Wir sind der Überzeugung, dass unabhängig von der Frage, ob eine diesbezügliche gesetzliche Verbindlichkeit besteht oder nicht, es zur good governance eines jeden Unternehmens gehört, die Menschenrechte in ihrer Geschäftstätigkeit zu respektieren, sich der menschenrechtlichen Risiken der eigenen unternehmerischen Tätigkeit bewusst zu sein und die notwendigen Schritte zu ergreifen, um diesbezügliche negative Externalitäten der eigenen Tätigkeit zu minimieren und zu beseitigen. Gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass Menschenrechtskonformität von unternehmerischer Tätigkeit nicht einfach mittels Umlegens eines Hebels bewerkstelligt werden kann, sondern vielmehr ein fortlaufender Lernprozess ist. Aus diesem Grund werden wir uns auch im kommenden Jahr wiederum bemühen verschiedene Workshops und Food for Thoughts Sessions mit nationalen und internationalen Expert*innen zu konkreten menschenrechtlichen Themen im wirtschaftlichen Kontext und zum Austausch von best practices anzubieten, um damit einen nachhaltigen Beitrag zu leisten, dass noch mehr Unternehmen von sich aus den Weg Richtung nachhaltiger menschenrechtskonformer Unternehmertätigkeit einschlagen oder ihre diesbezüglich bereits ergriffenen Bemühungen intensivieren.